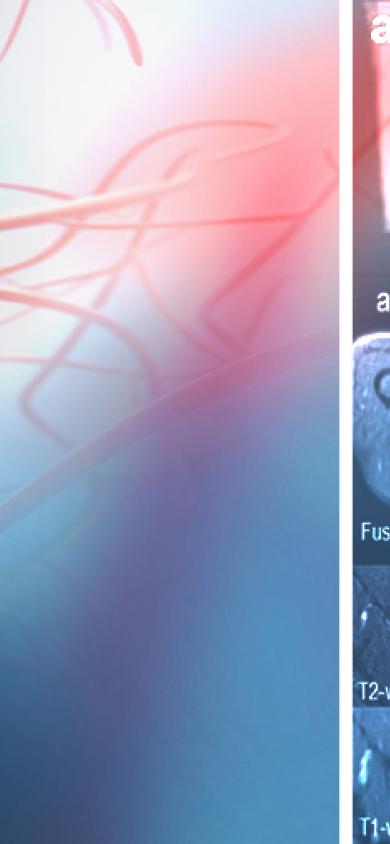Periphere Arterielle Katheterinterventionen
Einer unserer wissenschaftlichen Schwerpunkte liegt im Bereich arterieller Gefäßeingriffe zur Behandlung der Gefäßverkalkung, sog. peripherer arterielle Verschlusskrankheit. Dies ist eine häufige Erkrankung, die meist durch Atherosklerose bedingt ist und die in unterschiedlichen Gefäßstrombahnen des Körpers betreffen kann. In unserer Forschungstätigkeit beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Beurteilung verschiedener Kathetertherapien. Hierzu führen wir eine Vielzahl klinischer Studien in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen in unserem Hause durch, um eine Optimierung der endovaskulären Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit für unserer Patienten zu erreichen. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit der medikamentösen Nachbehandlung nach Stentimplantationen, insbesondere mit neuartigen Kombinationstherapien zur Vermeidung von Stentthrombosen und InStent-Restenosen.
Periphere Venöse Katheterinterventionen
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt stellt die endovaskuläre Behandlung von akuten Thrombosen sowie des postthrombotischen Syndroms dar. Kathetereingriffe rücken zunehmend in der Behandlung von Becken- und Beinvenen beispielsweise durch Thrombolyseverfahren oder durch mechanische Entfernung von Thrombosen bzw. mittels Stenting in den Fokus. Sowohl Fragen zur technischen Erfolgsquote sowie Aufrechterhaltung der langfristigen Durchgängigkeit venöser Gefäße nach Wiedereröffnungen sind von wesentlichem Interesse.
Seit kurzem beschäftigen wir uns mit endovaskulären Therapiestrategien des postthrombotischen Syndroms der oberen Extremität bei Armvenenthrombose z.B. nach Schrittmacherimplantation, ein bisher oft vernachlässigtem Erkrankungsbild.
Entstehung, Diagnostik und Therapie der Lungenarterienembolie
Die Behandlung der akuten Lungenembolie ist durch die Entwicklung neuer interventioneller Behandlungsansätze in der jüngsten Vergangenheit von großem Interesse. Der Schwerpunkt unserer Forschungstätigkeit liegt in der Beurteilung neuer Katheterverfahren, insbesondere zur Thrombusaspiration (mittels Aspirationskatheter) und lokalen Lyse (Lysekatheter). Unsere Arbeitsgruppe nimmt u.a. an internationalen multizentrischen Studien und Registern, wie bspw. der HI-PEITHO-Studie.
Ein weiterer Schwerpunkt umfasst histologische und bildgebungstechnische Untersuchungen, wie CT- und MRT zur Charakterisierung und Zusammensetzung von venösen Thromben bei Lungenarterienembolie dar. Dabei spielt die Bestimmung des Thrombusalters und der Thrombusmorphologie zur Unterscheidung einer akuten, subakuten oder chronischen Lungenarterienembolie eine wesentliche Rolle, insbesondere in Hinblick auf den Erfolg der einzelnen Therapieansätze. Unsere Arbeitsgruppe arbeitet bei diesen Projekten eng mit dem Institut für Radiologie und dem Institut für Pathologie an unserem Klinikum zusammen. Ziel der Projekte ist es, die personalisierte Medizin in der Behandlung von PatientInnen mit Lungenarterienembolie weiter voranzutreiben. Unsere Projekte werden unter anderem durch die Deutsche Stiftung für Herzforschung gefördert .
Multimodale Bildgebung
Weitere Schwerpunkte der Arbeitsgruppe liegen im Bereich der multimodalen Bildgebung atherosklerotischer Plaques, die wir in enger Kooperation mit der Nuklearmedizinischen Klinik sowie mit dem Institut für Radiologie des Klinikums durchführen. Diese Untersuchungen zielen auf die Charakterisierung von atherosklerotischen Plaques ab, insbesondere auf die Erkennung von gefährlichen, sog. vulnerablen Plaques. Unsere Expertise umfasst die multimodale invasive und nicht-invasive Bildgebung, darunter Methoden wie Computer- bzw. Magnetresonanztomographie sowie PET-MRT und optische Kohärenztomographie (OCT). Durch die Kombination verschiedener bildgebender Verfahren erhalten wir umfassende Erkenntnisse in die Entwicklung und in dem Fortschreiten der Artherosklerose von Gefäßen, was in der Zukunft eine mögliche Planung eines zielgerichteten Therapieansatzes bei Patienten mit arteriellen Gefäßerkrankungen zulassen kann.
Team
Ärzte
- Prof. Dr. med. Tareq Ibrahim
Leitender Oberarzt | Leiter der Angiologie - Dr. med. Christian Bradaric
Oberarzt | Stellv. Leiter der Angiologie - PD Dr. med. Arne M. Müller
Oberarzt - Dr. med. Katharina Bergmann
Oberärztin -
Dr. med. Marcus Brugger
Assistenzarzt
Pflegepersonal
- Marija Cvitanovic
Sekretariat
- Daniela Bogdanovic
Publikationen (ausgewählt)
Wustrow I, Sarafoff N, Haller B, Rossner L, Sibbing D, Schupke S, Ibrahim T, Anetsberger A, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Bernlochner I. Real clinical experiences of dual versus triple antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention. Catheterization and cardiovascular interventions: official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions. 2018;92:1239-1246.
von Olshausen G, Pfeiffer D, Muller A and Ibrahim T. Multifocal bilateral palmar and digital varices. European heart journal. 2018;39:2762.
Vitadello T, Renders L, Munzel D, Huber A and Ibrahim T. Late renal revascularization and salvage due to unexpected collaterals. Kidney international. 2018;93:1491.
Steger A, Weichert W, Ibrahim T and Rischpler C. Isolated cardiac sarcoidosis: the crucial role of multimodal imaging with positron emission tomography/magnetic resonance imaging in diagnosis and therapy surveillance. European heart journal. 2018;39:488.
Muller AM, Langwieser N, Bradaric C, Haller B, Fusaro M, Ott I, von Beckerath N, Kastrati A, Laugwitz KL and Ibrahim T. Endovascular Treatment for Steno-Occlusive Iliac Artery Disease: Safety and Long-Term Outcome. Angiology. 2018;69:308-315.
Mankerious N, Mayer K, Gewalt SM, Helde SM, Ibrahim T, Bott-Flugel L, Laugwitz KL, Schunkert H, Kastrati A and Schupke S. Comparison of the FemoSeal Vascular Closure Device With Manual Compression After Femoral Artery Puncture - Post-hoc Analysis of a Large-Scale, Randomized Clinical Trial. The Journal of invasive cardiology. 2018;30:235-239.
Lachmann M, Will A, Linhard M and Ibrahim T. Progression of a coronary artery aneurysm with symptomatic compression of cardiac structures. European heart journal. 2018;39:3336.
Lachmann M, Pfeiffer D and Ibrahim T. An Unexpected Origin of Fluctuating Pulsatile Tinnitus. JACC Cardiovascular interventions. 2018;11:e189-e190.
Kunze KP, Nekolla SG, Rischpler C, Zhang SH, Hayes C, Langwieser N, Ibrahim T, Laugwitz KL and Schwaiger M. Myocardial perfusion quantification using simultaneously acquired (13) NH3 -ammonia PET and dynamic contrast-enhanced MRI in patients at rest and stress. Magnetic resonance in medicine. 2018;80:2641-2654.
Kunze KP, Dirschinger RJ, Kossmann H, Hanus F, Ibrahim T, Laugwitz KL, Schwaiger M, Rischpler C and Nekolla SG. Quantitative cardiovascular magnetic resonance: extracellular volume, native T1 and 18F-FDG PET/CMR imaging in patients after revascularized myocardial infarction and association with markers of myocardial damage and systemic inflammation. Journal of cardiovascular magnetic resonance : official journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. 2018;20:33.
Koppara T, Tada T, Xhepa E, Kufner S, Byrne RA, Ibrahim T, Laugwitz KL, Kastrati A and Joner M. Randomised comparison of vascular response to biodegradable polymer sirolimus eluting and permanent polymer everolimus eluting stents: An optical coherence tomography study. International journal of cardiology. 2018;258:42-49.
Gewalt SM, Helde SM, Ibrahim T, Mayer K, Schmidt R, Bott-Flugel L, Hoppe K, Ott I, Hieber J, Morath T, Byrne RA, Kufner S, Cassese S, Hoppmann P, Fusaro M, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Schupke S. Comparison of Vascular Closure Devices Versus Manual Compression After Femoral Artery Puncture in Women. Circulation Cardiovascular interventions. 2018;11:e006074.
Colleran R, Kufner S, Mehilli J, Rosenbeiger C, Schupke S, Hoppmann P, Joner M, Mankerious N, Fusaro M, Cassese S, Abdel-Wahab M, Neumann FJ, Richardt G, Ibrahim T, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Efficacy Over Time With Drug-Eluting Stents in Saphenous Vein Graft Lesions. Journal of the American College of Cardiology. 2018;71:1973-1982.
Colleran R, Joner M, Kufner S, Altevogt F, Neumann FJ, Abdel-Wahab M, Bohner J, Valina C, Richardt G, Zrenner B, Cassese S, Ibrahim T, Laugwitz KL, Schunkert H, Kastrati A and Byrne RA. Comparative efficacy of two paclitaxel-coated balloons with different excipient coatings in patients with coronary in-stent restenosis: A pooled analysis of the Intracoronary Stenting and Angiographic Results: Optimizing Treatment of Drug Eluting Stent In-Stent Restenosis 3 and 4 (ISAR-DESIRE 3 and ISAR-DESIRE 4) trials. International journal of cardiology. 2018;252:57-62.
Cassese S, Wolf F, Ingwersen M, Kinstner CM, Fusaro M, Ndrepepa G, Ibrahim T, Ott I, Lammer J, Krankenberg H and Fusaro M. Drug-Coated Balloon Angioplasty for Femoropopliteal In-Stent Restenosis. Circulation Cardiovascular interventions. 2018;11:e007055.
Buiatti A, von Olshausen G, Martens E, Schinke K, Laugwitz KL, Hoppmann P and Ibrahim T. Balloon angioplasty versus stenting for pulmonary vein stenosis after pulmonary vein isolation for atrial fibrillation: A meta-analysis. International journal of cardiology. 2018;254:146-150.
Xhepa E, Tada T, Kufner S, Ndrepepa G, Byrne RA, Kreutzer J, Ibrahim T, Tiroch K, Valgimigli M, Tolg R, Cassese S, Fusaro M, Schunkert H, Laugwitz KL, Mehilli J and Kastrati A. Long-term prognostic value of risk scores after drug-eluting stent implantation for unprotected left main coronary artery: A pooled analysis of the ISAR-LEFT-MAIN and ISAR-LEFT-MAIN 2 randomized clinical trials. Catheterization and cardiovascular interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions. 2017;89:1-10.
Vitadello T, Eichinger W, Huber A and Ibrahim T. An unexpected cause of recurrent myocardial infarction. European heart journal cardiovascular Imaging. 2017;18:486.
Steppich B, Groha P, Ibrahim T, Schunkert H, Laugwitz KL, Hadamitzky M, Kastrati A and Ott I. Effect of Erythropoietin in patients with acute myocardial infarction: five-year results of the REVIVAL-3 trial. BMC cardiovascular disorders. 2017;17:38.
Ott I, Cassese S, Groha P, Steppich B, Voll F, Hadamitzky M, Ibrahim T, Kufner S, Dewitz K, Wittmann T, Kasel AM, Laugwitz KL, Schunkert H, Kastrati A and Fusaro M. ISAR-PEBIS (Paclitaxel-Eluting Balloon Versus Conventional Balloon Angioplasty for In-Stent Restenosis of Superficial Femoral Artery): A Randomized Trial. Journal of the American Heart Association. 2017;6.
Ott I, Cassese S, Groha P, Steppich B, Hadamitzky M, Ibrahim T, Kufner S, Dewitz K, Hiendlmayer R, Laugwitz KL, Schunkert H, Kastrati A and Fusaro M. Randomized Comparison of Paclitaxel-Eluting Balloon and Stenting Versus Plain Balloon Plus Stenting Versus Directional Atherectomy for Femoral Artery Disease (ISAR-STATH). Circulation. 2017;135:2218-2226.
Langwieser N, Laugwitz KL and Ibrahim T. Comprehensive endovascular treatment of multiple arterial emboli involving LIMA graft, distal aorta and upper and lower extremities in a patient with subacute cerebral hemorrhage. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2017;106:230-233.
Kunze KP, Rischpler C, Hayes C, Ibrahim T, Laugwitz KL, Haase A, Schwaiger M and Nekolla SG. Measurement of extracellular volume and transit time heterogeneity using contrast-enhanced myocardial perfusion MRI in patients after acute myocardial infarction. Magnetic resonance in medicine. 2017;77:2320-2330.
Kufner S, Joner M, Schneider S, Tolg R, Zrenner B, Repp J, Starkmann A, Xhepa E, Ibrahim T, Cassese S, Fusaro M, Ott I, Hengstenberg C, Schunkert H, Abdel-Wahab M, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Neointimal Modification With Scoring Balloon and Efficacy of Drug-Coated Balloon Therapy in Patients With Restenosis in Drug-Eluting Coronary Stents: A Randomized Controlled Trial. JACC Cardiovascular interventions. 2017;10:1332-1340.
Karlas A, Reber J, Diot G, Bozhko D, Anastasopoulou M, Ibrahim T, Schwaiger M, Hyafil F and Ntziachristos V. Flow-mediated dilatation test using optoacoustic imaging: a proof-of-concept. Biomedical optics express. 2017;8:3395-3403.
Ibrahim T, Muenzel D, Babaryka G, Barthel P and Thurmel K. Affection of the cardiovascular system by IgG4-related disease. European heart journal cardiovascular Imaging. 2017;18:485.
Ibrahim T, Dommasch M, Huber A and Hoppmann P. Percutaneous revascularization of concurrently obstructed left-sided pulmonary veins complicating catheter ablation for atrial fibrillation. European heart journal. 2017;38:26.
Harada Y, Michel J, Lohaus R, Mayer K, Emmer R, Lahmann AL, Colleran R, Giacoppo D, Wolk A, Ten Berg JM, Neumann FJ, Han Y, Adriaenssens T, Tolg R, Seyfarth M, Maeng M, Zrenner B, Jacobshagen C, Wohrle J, Kufner S, Morath T, Ibrahim T, Bernlochner I, Fischer M, Schunkert H, Laugwitz KL, Mehilli J, Byrne RA, Kastrati A and Schulz-Schupke S. Validation of the DAPT score in patients randomized to 6 or 12 months clopidogrel after predominantly second-generation drug-eluting stents. Thrombosis and haemostasis. 2017;117:1989-1999.
Harada Y, Colleran R, Pinieck S, Giacoppo D, Michel J, Kufner S, Cassese S, Joner M, Ibrahim T, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Angiographic and clinical outcomes of patients treated with drug-coated balloon angioplasty for in-stent restenosis after coronary bifurcation stenting with a two-stent technique. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2017;12:2132-2139.
Dregely I, Koppara T, Nekolla SG, Nahrig J, Kuhs K, Langwieser N, Dzijan-Horn M, Ganter C, Joner M, Laugwitz KL, Schwaiger M and Ibrahim T. Observations With Simultaneous 18F-FDG PET and MR Imaging in Peripheral Artery Disease. JACC Cardiovascular imaging. 2017;10:709-711.
Dommasch M and Ibrahim T. Reply: Absorb-BVS Resorption and Imaging Findings: Clarifying Current Misconceptions. JACC Cardiovascular interventions. 2017;10:747-748.
Colleran R, Kufner S, Harada Y, Giacoppo D, Cassese S, Repp J, Wiebe J, Lohaus R, Lahmann A, Schneider S, Ibrahim T, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Five-year follow-up of polymer-free sirolimus- and probucol-eluting stents versus new generation zotarolimus-eluting stents in patients presenting with st-elevation myocardial infarction. Catheterization and cardiovascular interventions : official journal of the Society for Cardiac Angiography & Interventions. 2017;89:367-374.
Colleran R, Harada Y, Kufner S, Giacoppo D, Joner M, Cassese S, Ibrahim T, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Changes in high-sensitivity troponin after drug-coated balloon angioplasty for drug-eluting stent restenosis. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2017;13:962-969.
Bradaric C, Eser K, Preuss S, Dommasch M, Wustrow I, Langwieser N, Haller B, Ott I, Fusaro M, Heemann U, Laugwitz KL, Kastrati A and Ibrahim T. Drug-eluting stents versus bare metal stents for the prevention of restenosis in patients with renovascular disease. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2017;13:e248-e255.
Wiebe J, Hoppmann P, Kufner S, Harada Y, Colleran R, Michel J, Giacoppo D, Schneider S, Cassese S, Ibrahim T, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Impact of stent size on angiographic and clinical outcomes after implantation of everolimus-eluting bioresorbable scaffolds in daily practice: insights from the ISAR-ABSORB registry. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2016;12:e137-43.
Steppich B, Hadamitzky M, Ibrahim T, Groha P, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Ott I. Stem cell mobilisation by granulocyte-colony stimulating factor in patients with acute myocardial infarction. Long-term results of the REVIVAL-2 trial. Thrombosis and haemostasis. 2016;115:864-8.
Rischpler C, Dirschinger RJ, Nekolla SG, Kossmann H, Nicolosi S, Hanus F, van Marwick S, Kunze KP, Meinicke A, Gotze K, Kastrati A, Langwieser N, Ibrahim T, Nahrendorf M, Schwaiger M and Laugwitz KL. Prospective Evaluation of 18F-Fluorodeoxyglucose Uptake in Postischemic Myocardium by Simultaneous Positron Emission Tomography/Magnetic Resonance Imaging as a Prognostic Marker of Functional Outcome. Circulation Cardiovascular imaging. 2016;9:e004316.
Lohaus R, Michel J, Mayer K, Lahmann AL, Byrne RA, Wolk A, Ten Berg JM, Neumann FJ, Han Y, Adriaenssens T, Tolg R, Seyfarth M, Maeng M, Zrenner B, Jacobshagen C, Wohrle J, Kufner S, Morath T, Ibrahim T, Bernlochner I, Fischer M, Schunkert H, Laugwitz KL, Mehilli J, Kastrati A and Schulz-Schupke S. Six Versus Twelve Months Clopidogrel Therapy After Drug-Eluting Stenting in Patients With Acute Coronary Syndrome: An ISAR-SAFE Study Subgroup Analysis. Scientific reports. 2016;6:33054.
Langwieser N, Bernlochner I, Wustrow I, Dirschinger RJ, Jaitner J, Dommasch M, Bradaric C, Laugwitz KL and Ibrahim T. Combination of factor Xa inhibition and antiplatelet therapy after stenting in patients with iliofemoral post-thrombotic venous obstruction. Phlebology. 2016;31:430-7.
Kufner S, Sorges J, Mehilli J, Cassese S, Repp J, Wiebe J, Lohaus R, Lahmann A, Rheude T, Ibrahim T, Massberg S, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Randomized Trial of Polymer-Free Sirolimus- and Probucol-Eluting Stents Versus Durable Polymer Zotarolimus-Eluting Stents: 5-Year Results of the ISAR-TEST-5 Trial. JACC Cardiovascular interventions. 2016;9:784-792.
Kufner S, Byrne RA, Valeskini M, Schulz S, Ibrahim T, Hoppmann P, Schneider S, Laugwitz KL, Schunkert H and Kastrati A. Five-year outcomes from a trial of three limus-eluting stents with different polymer coatings in patients with coronary artery disease: final results from the ISAR-TEST 4 randomised trial. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2016;11:1372-9.
Ibrahim T, Dirschinger R, Hein R and Jaitner J. Downstream Panniculitis Secondary to Drug-Eluting Balloon Angioplasty. JACC Cardiovascular interventions. 2016;9:e177-9.
Harada Y, Colleran R, Kufner S, Giacoppo D, Rheude T, Michel J, Cassese S, Ibrahim T, Laugwitz KL, Kastrati A and Byrne RA. Five-year clinical outcomes in patients with diabetes mellitus treated with polymer-free sirolimus- and probucol-eluting stents versus second-generation zotarolimus-eluting stents: a subgroup analysis of a randomized controlled trial. Cardiovascular diabetology. 2016;15:124.
Dommasch M, Langwieser N, Laugwitz KL and Ibrahim T. Malabsorption of a Bioresorbable Vascular Scaffold System Leading to Very Late In-Scaffold Restenosis More Than 3.5 Years After Implantation: Assessment by Optical Coherence Tomography. JACC Cardiovascular interventions. 2016;9:2571-2572.
Cassese S, Kufner S, Xhepa E, Byrne RA, Kreutzer J, Ibrahim T, Tiroch K, Valgimigli M, Tolg R, Fusaro M, Schunkert H, Laugwitz KL, Mehilli J and Kastrati A. Three-year efficacy and safety of new- versus early-generation drug-eluting stents for unprotected left main coronary artery disease insights from the ISAR-LEFT MAIN and ISAR-LEFT MAIN 2 trials. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2016;105:575-84.
Bernlochner I, Jaitner J, Fries V, Dommasch M, Mayer K, Ott I, Langwieser N, Fusaro M, Laugwitz KL, Kastrati A and Ibrahim T. High on-treatment platelet reactivity and outcomes after percutaneous endovascular procedures in patients with peripheral artery disease. VASA Zeitschrift fur Gefasskrankheiten. 2016;45:155-61.
Schulz-Schupke S, Byrne RA, Ten Berg JM, Neumann FJ, Han Y, Adriaenssens T, Tolg R, Seyfarth M, Maeng M, Zrenner B, Jacobshagen C, Mudra H, von Hodenberg E, Wohrle J, Angiolillo DJ, von Merzljak B, Rifatov N, Kufner S, Morath T, Feuchtenberger A, Ibrahim T, Janssen PW, Valina C, Li Y, Desmet W, Abdel-Wahab M, Tiroch K, Hengstenberg C, Bernlochner I, Fischer M, Schunkert H, Laugwitz KL, Schomig A, Mehilli J and Kastrati A. ISAR-SAFE: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 6 vs. 12 months of clopidogrel therapy after drug-eluting stenting. European heart journal. 2015;36:1252-63.
Schinke K, Langwieser N, Laugwitz KL and Ibrahim T. A potential life-threatening complication after implantation of a bioresorbable scaffold for coronary stenting within a mechanically stressed region. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2015;104:366-7.
Rischpler C, Langwieser N, Souvatzoglou M, Batrice A, van Marwick S, Snajberk J, Ibrahim T, Laugwitz KL, Nekolla SG and Schwaiger M. PET/MRI early after myocardial infarction: evaluation of viability with late gadolinium enhancement transmurality vs. 18F-FDG uptake. European heart journal cardiovascular Imaging. 2015;16:661-9.
Rasper M, Gramer BM, Settles M, Laugwitz KL, Ibrahim T, Rummeny EJ and Huber A. Dual-source RF transmission in cardiac SSFP imaging at 3 T: systematic spatial evaluation of image quality improvement compared to conventional RF transmission. Clinical imaging. 2015;39:231-6.
Langwieser N, Prechtl L, Meidert AS, Hapfelmeier A, Bradaric C, Ibrahim T, Laugwitz KL, Schmid RM, Wagner JY and Saugel B. Radial artery applanation tonometry for continuous noninvasive arterial blood pressure monitoring in the cardiac intensive care unit. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2015;104:518-24.
Ibrahim T, Langwieser N, Dommasch M, Wildgruber M, Laugwitz KL, Krankenberg H, Roffi M and Cremonesi A. How should I treat a complex left subclavian artery stenosis involving the vertebral artery in a patient with subclavian steal syndrome and left internal mammary artery bypass graft? EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2015;10:e1-7.
Fiedler KA, Maeng M, Mehilli J, Schulz-Schupke S, Byrne RA, Sibbing D, Hoppmann P, Schneider S, Fusaro M, Ott I, Kristensen SD, Ibrahim T, Massberg S, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Sarafoff N. Duration of Triple Therapy in Patients Requiring Oral Anticoagulation After Drug-Eluting Stent Implantation: The ISAR-TRIPLE Trial. Journal of the American College of Cardiology. 2015;65:1619-1629.
Cassese S, Byrne RA, Schulz S, Hoppman P, Kreutzer J, Feuchtenberger A, Ibrahim T, Ott I, Fusaro M, Schunkert H, Laugwitz KL and Kastrati A. Prognostic role of restenosis in 10 004 patients undergoing routine control angiography after coronary stenting. European heart journal. 2015;36:94-9.
Bradaric C, Kuhs K, Groha P, Dommasch M, Langwieser N, Haller B, Ott I, Fusaro M, Theiss W, von Beckerath N, Kastrati A, Laugwitz KL and Ibrahim T. Endovascular therapy for steno-occlusive subclavian and innominate artery disease. Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society. 2015;79:537-43.
Xhepa E, Byrne RA, Schulz S, Helde S, Gewalt S, Cassese S, Linhardt M, Ibrahim T, Mehilli J, Hoppe K, Grupp K, Kufner S, Bottiger C, Hoppmann P, Burgdorf C, Fusaro M, Ott I, Schneider S, Hengstenberg C, Schunkert H, Laugwitz KL and Kastrati A. Rationale and design of a randomised clinical trial comparing vascular closure device and manual compression to achieve haemostasis after diagnostic coronary angiography: the Instrumental Sealing of ARterial puncture site - CLOSURE device versus manual compression (ISAR-CLOSURE) trial. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2014;10:198-203.
von Olshausen G, Hyafil F, Langwieser N, Laugwitz KL, Schwaiger M and Ibrahim T. Detection of acute inflammatory myocarditis in Epstein Barr virus infection using hybrid 18F-fluoro-deoxyglucose-positron emission tomography/magnetic resonance imaging. Circulation. 2014;130:925-6.
Schulz-Schupke S, Helde S, Gewalt S, Ibrahim T, Linhardt M, Haas K, Hoppe K, Bottiger C, Groha P, Bradaric C, Schmidt R, Bott-Flugel L, Ott I, Goedel J, Byrne RA, Schneider S, Burgdorf C, Morath T, Kufner S, Joner M, Cassese S, Hoppmann P, Hengstenberg C, Pache J, Fusaro M, Massberg S, Mehilli J, Schunkert H, Laugwitz KL and Kastrati A. Comparison of vascular closure devices vs manual compression after femoral artery puncture: the ISAR-CLOSURE randomized clinical trial. Jama. 2014;312:1981-7.
Schulz S, Richardt G, Laugwitz KL, Morath T, Neudecker J, Hoppmann P, Mehran R, Gershlick AH, Tolg R, Anette Fiedler K, Abdel-Wahab M, Kufner S, Schneider S, Schunkert H, Ibrahim T, Mehilli J and Kastrati A. Prasugrel plus bivalirudin vs. clopidogrel plus heparin in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. European heart journal. 2014;35:2285-94.
Schulz S, Richardt G, Laugwitz KL, Mehran R, Gershlick AH, Morath T, Mayer K, Neudecker J, Tolg R, Ibrahim T, Hauschke D, Braun D, Schunkert H, Kastrati A and Mehilli J. Comparison of prasugrel and bivalirudin vs clopidogrel and heparin in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: Design and rationale of the Bavarian Reperfusion Alternatives Evaluation (BRAVE) 4 trial. Clinical cardiology. 2014;37:270-6.
Schneider S, Batrice A, Rischpler C, Eiber M, Ibrahim T and Nekolla SG. Utility of multimodal cardiac imaging with PET/MRI in cardiac sarcoidosis: implications for diagnosis, monitoring and treatment. European heart journal. 2014;35:312.
Sarafoff N and Ibrahim T. The ECG in the setting of myocardial infarction, characterized by cardiac magnetic resonance imaging. Journal of electrocardiology. 2014;47:129-30.
Langwieser N, von Olshausen G, Rischpler C and Ibrahim T. Confirmation of diagnosis and graduation of inflammatory activity of Loeffler endocarditis by hybrid positron emission tomography/magnetic resonance imaging. European heart journal. 2014;35:2496.
Langwieser N, Sinnecker D, Rischpler C, Batrice A, van Marwick S, Schwaiger M, Laugwitz KL, Nekolla SG and Ibrahim T. Treatment of acute left main occlusion by early revascularization combined with extracorporeal circulation achieves substantial myocardial salvage as assessed by simultaneous positron emission tomography/magnetic resonance imaging. Resuscitation. 2014;85:e171-3.
Langwieser N, Prothmann S, Buyer D, Poppert H, Schuster T, Fusaro M, Barthel P, Haase HU, Laugwitz KL, Zimmer C and Ibrahim T. Safety and efficacy of different stent types for the endovascular therapy of extracranial vertebral artery disease. Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society. 2014;103:353-62.
Langwieser N, Buyer D, Schuster T, Haller B, Laugwitz KL and Ibrahim T. Bare metal vs. drug-eluting stents for extracranial vertebral artery disease: a meta-analysis of nonrandomized comparative studies. Journal of endovascular therapy : an official journal of the International Society of Endovascular Specialists. 2014;21:683-92.
Hadamitzky M, Langhans B, Hausleiter J, Sonne C, Byrne RA, Mehilli J, Kastrati A, Schomig A, Martinoff S and Ibrahim T. Prognostic value of late gadolinium enhancement in cardiovascular magnetic resonance imaging after acute ST-elevation myocardial infarction in comparison with single-photon emission tomography using Tc99m-Sestamibi. European heart journal cardiovascular Imaging. 2014;15:216-25.
Guerra E, Ndrepepa G, Schulz S, Byrne R, Hoppmann P, Kufner S, Ibrahim T, Tada T, Schunkert H, Laugwitz KL and Kastrati A. Impact of inhospital stent thrombosis and cerebrovascular accidents on long-term prognosis after percutaneous coronary intervention. American heart journal. 2014;168:862-8.e1.
Guerra E, Hadamitzky M, Ndrepepa G, Bauer C, Ibrahim T, Ott I, Laugwitz KL, Schunkert H and Kastrati A. Microvascular obstruction in patients with non-ST-elevation myocardial infarction: a contrast-enhanced cardiac magnetic resonance study. The international journal of cardiovascular imaging. 2014;30:1087-95.
Fiedler KA, Mehilli J, Kufner S, Schlichting A, Ibrahim T, Sibbing D, Ott I, Schunkert H, Laugwitz KL, Kastrati A and Schulz S. Randomised, double-blind trial on the value of tapered discontinuation of clopidogrel maintenance therapy after drug-eluting stent implantation. Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen: CAUTION in Discontinuing Clopidogrel Therapy--ISAR-CAUTION. Thrombosis and haemostasis. 2014;111:1041-9.
Fiedler KA, Byrne RA, Schulz S, Sibbing D, Mehilli J, Ibrahim T, Maeng M, Laugwitz KL, Kastrati A and Sarafoff N. Rationale and design of The Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen-Testing of a six-week versus a six-month clopidogrel treatment Regimen In Patients with concomitant aspirin and oraL anticoagulant therapy following drug-Eluting stenting (ISAR-TRIPLE) study. American heart journal. 2014;167:459-465.e1.
Dzijan-Horn M, Langwieser N, Groha P, Bradaric C, Linhardt M, Bottiger C, Byrne RA, Steppich B, Koppara T, Godel J, Hadamitzky M, Ott I, von Beckerath N, Kastrati A, Laugwitz KL and Ibrahim T. Safety and efficacy of a potential treatment algorithm by using manual compression repair and ultrasound-guided thrombin injection for the management of iatrogenic femoral artery pseudoaneurysm in a large patient cohort. Circulation Cardiovascular interventions. 2014;7:207-15.
Cassese S, Byrne RA, Tada T, Pinieck S, Joner M, Ibrahim T, King LA, Fusaro M, Laugwitz KL and Kastrati A. Incidence and predictors of restenosis after coronary stenting in 10 004 patients with surveillance angiography. Heart (British Cardiac Society). 2014;100:153-9.
Tada T, Byrne RA, Simunovic I, King LA, Cassese S, Joner M, Fusaro M, Schneider S, Schulz S, Ibrahim T, Ott I, Massberg S, Laugwitz KL and Kastrati A. Risk of stent thrombosis among bare-metal stents, first-generation drug-eluting stents, and second-generation drug-eluting stents: results from a registry of 18,334 patients. JACC Cardiovascular interventions. 2013;6:1267-74.
Sarafoff N, Schuster T, Vochem R, Fichtner S, Martinoff S, Schwaiger M, Schomig A and Ibrahim T. Association of ST-elevation and non-ST-elevation presentation on ECG with transmurality and size of myocardial infarction as assessed by contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Journal of electrocardiology. 2013;46:100-6.
Orban M, Joner M, Riegger J, Steigerwald K, Tada T, Ibrahim T, Laugwitz KL, Byrne RA, Kastrati A and Massberg S. Time does not heal all wounds: very late stent thrombosis eight years after implantation of a sirolimus-eluting stent due to positive remodelling, saccular evaginations and marked vascular inflammation. EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology. 2013;9:412-3.
Ndrepepa G, Schulz S, Neumann FJ, Byrne RA, Hoppmann P, Cassese S, Ott I, Fusaro M, Ibrahim T, Tada T, Richardt G, Laugwitz KL, Schunkert H and Kastrati A. Bleeding after percutaneous coronary intervention in women and men matched for age, body mass index, and type of antithrombotic therapy. American heart journal. 2013;166:534-40.
Ndrepepa G, Neumann FJ, Richardt G, Schulz S, Tolg R, Stoyanov KM, Gick M, Ibrahim T, Fiedler KA, Berger PB, Laugwitz KL and Kastrati A. Prognostic value of access and non-access sites bleeding after percutaneous coronary intervention. Circulation Cardiovascular interventions. 2013;6:354-61.
Mehilli J, Richardt G, Valgimigli M, Schulz S, Singh A, Abdel-Wahab M, Tiroch K, Pache J, Hausleiter J, Byrne RA, Ott I, Ibrahim T, Fusaro M, Seyfarth M, Laugwitz KL, Massberg S and Kastrati A. Zotarolimus- versus everolimus-eluting stents for unprotected left main coronary artery disease. Journal of the American College of Cardiology. 2013;62:2075-82.
Langhans B, Ibrahim T, Hausleiter J, Sonne C, Martinoff S, Schomig A and Hadamitzky M. Gender differences in contrast-enhanced magnetic resonance imaging after acute myocardial infarction. The international journal of cardiovascular imaging. 2013;29:643-50.
Koppara T, Fusaro M, Will A and Ibrahim T. Vertebral artery pseudoaneurysm complicating transaxillar aortic valve implantation. European heart journal. 2013;34:3471.
Ibrahim T, Karmann S, Schuster T, Fusaro M, Ott I, Bottiger C, Paschalidis M, Hilger JK, Poppert H, Theiss W and von Beckerath N. Safety and mid-term outcome of endovascular therapy for internal carotid artery disease: a 15-year experience at a single-centre angiology institution. VASA Zeitschrift fur Gefasskrankheiten. 2013;42:196-207.
Hadamitzky M, Langhans B, Hausleiter J, Sonne C, Kastrati A, Martinoff S, Schomig A and Ibrahim T. The assessment of area at risk and myocardial salvage after coronary revascularization in acute myocardial infarction: comparison between CMR and SPECT. JACC Cardiovascular imaging. 2013;6:358-69.
Byrne RA, Neumann FJ, Mehilli J, Pinieck S, Wolff B, Tiroch K, Schulz S, Fusaro M, Ott I, Ibrahim T, Hausleiter J, Valina C, Pache J, Laugwitz KL, Massberg S and Kastrati A. Paclitaxel-eluting balloons, paclitaxel-eluting stents, and balloon angioplasty in patients with restenosis after implantation of a drug-eluting stent (ISAR-DESIRE 3): a randomised, open-label trial. Lancet (London, England). 2013;381:461-7.
Ibrahim T, Nekolla SG, Langwieser N, Rischpler C, Groha P, Laugwitz KL and Schwaiger M. Simultaneous positron emission tomography/magnetic resonance imaging identifies sustained regional abnormalities in cardiac metabolism and function in stress-induced transient midventricular ballooning syndrome: a variant of Takotsubo cardiomyopathy. Circulation. 2012;126:e324-6.
Sarafoff N, Vochem R, Fichtner S, Martinoff S, Schwaiger M, Schomig A and Ibrahim T. Diagnostic value of standard and extended ECG leads for the detection of acute myocardial infarction as compared to contrast-enhanced magnetic resonance imaging. International journal of cardiology. 2011;152:103-5.
Mehilli J, Pache J, Abdel-Wahab M, Schulz S, Byrne RA, Tiroch K, Hausleiter J, Seyfarth M, Ott I, Ibrahim T, Fusaro M, Laugwitz KL, Massberg S, Neumann FJ, Richardt G, Schomig A and Kastrati A. Drug-eluting versus bare-metal stents in saphenous vein graft lesions (ISAR-CABG): a randomised controlled superiority trial. Lancet (London, England). 2011;378:1071-8.
Massberg S, Byrne RA, Kastrati A, Schulz S, Pache J, Hausleiter J, Ibrahim T, Fusaro M, Ott I, Schomig A, Laugwitz KL and Mehilli J. Polymer-free sirolimus- and probucol-eluting versus new generation zotarolimus-eluting stents in coronary artery disease: the Intracoronary Stenting and Angiographic Results: Test Efficacy of Sirolimus- and Probucol-Eluting versus Zotarolimus-eluting Stents (ISAR-TEST 5) trial. Circulation. 2011;124:624-32.
Ibrahim T, Blanke F, Huss-Marp J, Will A, von Bubnoff N, Martinoff S and Schomig A. Gadolinium-enhanced cardiovascular magnetic resonance for the detection and characterization of Loeffler endocarditis in patients with hypereosinophilic syndrome. International journal of cardiology. 2011;153:105-8.
Ott I, Schulz S, Mehilli J, Fichtner S, Hadamitzky M, Hoppe K, Ibrahim T, Martinoff S, Massberg S, Laugwitz KL, Dirschinger J, Schwaiger M, Kastrati A and Schmig A. Erythropoietin in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention: a randomized, double-blind trial. Circulation Cardiovascular interventions. 2010;3:408-13.
Ibrahim T, Hackl T, Nekolla SG, Breuer M, Feldmair M, Schomig A and Schwaiger M. Acute myocardial infarction: serial cardiac MR imaging shows a decrease in delayed enhancement of the myocardium during the 1st week after reperfusion. Radiology. 2010;254:88-97.
Ibrahim T, Makowski MR, Jankauskas A, Maintz D, Karch M, Schachoff S, Manning WJ, Schomig A, Schwaiger M and Botnar RM. Serial contrast-enhanced cardiac magnetic resonance imaging demonstrates regression of hyperenhancement within the coronary artery wall in patients after acute myocardial infarction. JACC Cardiovascular imaging. 2009;2:580-8.
Spuentrup E, Botnar RM, Wiethoff AJ, Ibrahim T, Kelle S, Katoh M, Ozgun M, Nagel E, Vymazal J, Graham PB, Gunther RW and Maintz D. MR imaging of thrombi using EP-2104R, a fibrin-specific contrast agent: initial results in patients. European radiology. 2008;18:1995-2005.
Keithahn A, Ibrahim T and Neff F. Evaluation of a fibroelastoma with magnetic resonance imaging. European heart journal. 2008;29:1480.
Wessely R, Botnar RM, Vorpahl M, Schwaiger M, Schomig A and Ibrahim T. Images in cardiovascular medicine. Subacute thrombotic occlusion and spontaneous recanalization of the right coronary artery after percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction visualized by coronary angiography and cardiac magnetic resonance imaging. Circulation. 2007;116:e78-80.
Ibrahim T, Bulow HP, Hackl T, Hornke M, Nekolla SG, Breuer M, Schomig A and Schwaiger M. Diagnostic value of contrast-enhanced magnetic resonance imaging and single-photon emission computed tomography for detection of myocardial necrosis early after acute myocardial infarction. Journal of the American College of Cardiology. 2007;49:208-16.
Adriaenssens T, Ibrahim T and Seyfarth M. The LEOPARD syndrome: a rare condition associated with hypertrophic cardiomyopathy. European heart journal. 2007;28:3066.
Zohlnhofer D, Ott I, Mehilli J, Schomig K, Michalk F, Ibrahim T, Meisetschlager G, von Wedel J, Bollwein H, Seyfarth M, Dirschinger J, Schmitt C, Schwaiger M, Kastrati A and Schomig A. Stem cell mobilization by granulocyte colony-stimulating factor in patients with acute myocardial infarction: a randomized controlled trial. Jama. 2006;295:1003-10.
Ibrahim T, Schwaiger M and Schomig A. Images in cardiovascular medicine. Assessment of isolated right ventricular myocardial infarction by magnetic resonance imaging. Circulation. 2006;113:e78-9.
Ibrahim T, Nekolla SG, Hornke M, Bulow HP, Dirschinger J, Schomig A and Schwaiger M. Quantitative measurement of infarct size by contrast-enhanced magnetic resonance imaging early after acute myocardial infarction: comparison with single-photon emission tomography using Tc99m-sestamibi. Journal of the American College of Cardiology. 2005;45:544-52.
Ibrahim T, Schreiber K, Dennig K, Schomig A and Schwaiger M. Images in cardiovascular medicine. Assessment of cor triatriatum sinistrum by magnetic resonance imaging. Circulation. 2003;108:e107.
Bengel FM, Lehnert J, Ibrahim T, Klein C, Bulow HP, Nekolla SG and Schwaiger M. Cardiac oxidative metabolism, function, and metabolic performance in mild hyperthyroidism: a noninvasive study using positron emission tomography and magnetic resonance imaging. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association. 2003;13:471-7.
Ibrahim T, Nekolla SG, Schreiber K, Odaka K, Volz S, Mehilli J, Guthlin M, Delius W and Schwaiger M. Assessment of coronary flow reserve: comparison between contrast-enhanced magnetic resonance imaging and positron emission tomography. Journal of the American College of Cardiology. 2002;39:864-70.
Ibrahim T, Dennig K, Schwaiger M and Schomig A. Images in cardiovascular medicine. Assessment of double chamber right ventricle by magnetic resonance imaging. Circulation. 2002;105:2692-3.
Wissenschaftliche Projekte & Drittmittelförderung
- Klinische Studien zur Evaluierung interventioneller Therapien bei de-novo bzw. Restenosen im Bereich der peripheren Strombahn (Unterschenkel, Oberschenkel, Subclavia etc.)
- Prädiktoren und Therapie der Stentthrombose nach endovaskulärer Revaskularisation der Oberschenkelstrombahn
- In-vivo Charakterisierung der arteriosklerotischen Gefäßplaque mittels moderner nicht-invasiver Schnittbildtechniken (PET/MRT, Spektral-CT) in der Oberschenkelstrombahn sowie am Herzen im Vergleich zu intravaskulärer Bildgebung mittels optischer Kohärenz-Tomographie
- Charakterisierung von In-Stent-Neoatherosklerose nach Stenting
- Epidemiologische Studien zur Prävalenz der pAVK im Rahmen von Wundheilungsstörungen nach elektiven orthopädischen Fußeingriffen.
- Endovaskuläre Behandlungen chronischer Venenverschlüsse in der Behandlung des postthrombotischen Syndroms
- Medikamentöse Therapie zur Blutverdünnung nach venöser Stent-Implantation